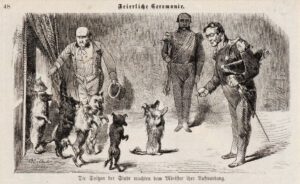Für Liebhaber des Deutschen Spitzes ist es stets interessant, die Rasse in historischen und literarischen Kontexten zu verorten. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür ist der Roman „Waldrausch“ von Ludwig Ganghofer, der 1908 erschien.
Ganghofer, geboren 1855 in Kaufbeuren, war tief in der bayerischen Heimat verwurzelt. Seine Heimatromane, inspiriert durch Aufenthalte in Orten wie Berchtesgaden, dem Königsee oder Ruhpolding, brachten ihm den Ruf des „Heile-Welt-Schreibers“ ein. Doch sein Roman „Waldrausch“ schildert nicht nur Idylle, sondern thematisiert den gesellschaftlichen Wandel und den beginnenden Fortschritt in den Alpentälern des frühen 20. Jahrhunderts.
Handlung von „Waldrausch“
Der Roman erzählt von der kontrastreichen Begegnung zweier Welten. Im Zentrum steht die ländliche Gemeinschaft im Aufbruch, deren Leben durch den Bau einer neuen Straße oder eines ähnlichen Infrastrukturprojekts grundlegend verändert wird. Dieses Fortschrittsprojekt wird vor allem von Urbanität und Industrie vorangetrieben. Ganghofer stellt die Spannung zwischen der Bewahrung der Natur und der Notwendigkeit des Fortschritts dar. Die Geschichte enthält die typischen Elemente eines Heimatromans: starke Naturverbundenheit, traditionelle Werte und emotionale Verstrickungen der Charaktere vor der Kulisse der majestätischen Alpen.

Der weiße Spitz „Sully“ – Ein Fremdkörper im Alpenidyll?
In dieser Schilderung von Wandel und Tradition versteckt sich ein für die Rasse des Deutschen Spitzes interessantes Detail: der weiße Spitz namens „Sully“.
Der Hund taucht als treuer Begleiter der jungen Frau „Beda“ auf. Einige Textstellen schildern Sully mit den typischen Spitzeigenarten: Er kläfft bei der kleinsten Unregelmäßigkeit und wird ungeduldig.
Die Erwähnung wirft aber auch Fragen auf:
- Symbolik der Rasse: Könnte der weiße Spitz das oft idealisierte, romantische Bild der bayerischen Heimat verkörpern, wie es Ganghofer pflegte? Die Wahl des Spitzes als traditioneller Wächter und Hofhund passt theoretisch in die ländliche Umgebung, doch die tatsächliche Verbreitung des (Groß-)Spitzes war in den Bergregionen um Berchtesgaden nicht übermäßig zahlreich, da hätte der Dackel eher ins Bild gepasst.
- Der Name „Sully“: Warum wählte Ganghofer einen so untypisch bayerischen Namen für einen Hund in einem Heimatroman? Diese Entscheidung bleibt ein Rätsel und könnte auf eine persönliche Anekdote, eine literarische Anspielung oder einfach auf einen Trend der damaligen Zeit hindeuten.
Ganghofers Roman Waldrausch wurde mehrfach verfilmt (1939, 1962, 1977). Bedauerlicherweise fand der literarische Spitz „Sully“ in keiner dieser Adaptionen eine Erwähnung oder visuelle Umsetzung. Damit bleibt der weiße Spitz ein reines, aber faszinierendes literarisches Detail, das uns heute erlaubt, über die Rolle und die Wahrnehmung des Deutschen Spitzes im bayerischen Kulturgut der Jahrhundertwende zu spekulieren.
Textstellen aus Waldrausch über den Spitz
Die Dialoge sind im bayerischen Dialekt geschrieben.
Kaum hundert Schritte hatte Ambros noch zu gehen, um das Haus der Wildacherin zu erreichen. Als er in den Hof trat, kläffte der weiße Spitz. Eine leise Stimme wies den Hund zur Ruhe. Und Ambros sah das Mädel auf der Holzbank sitzen. »Guten Abend, Beda!«
»Guten Abend! Der Träger hat schon alles auftragen in dein Stübl. Schafft der Herr noch ebbes?«
»Nein, ich danke.« Ambros lachte. Es wirkte immer heiter auf ihn, wenn Beda ›Herr‹ zu ihm sagte und ihn dabei duzte wie in der Kinderzeit. Er trat ins Haus. Beda wollte ihm folgen. Da sauste der Hund auf die Straße hinaus und begann ein Gebell, daß es an der nahen Bergwand ein Echo gab. »Sully!« rief das Mädchen mit scharfer Stimme. Sully hörte nicht, blieb auf der Straße draußen und kläffte. Als Beda ein paar Schritte gegen das Zauntor machte, sah sie in der Dämmerung den langen, schlanken Menschen stehen. »Schon wieder amal!« sprach sie in Zorn vor sich hin. Sie ging auf die Straße zu und fing, noch ehe sie den langen Menschen erreichte, zu reden an: »Was willst denn schon wieder? So a Narretei! Bei der Nachtzeit allweil umanandstehn vor meim Haus! D‘ Nachbarsleut reden schon drüber. Ich will mein‘ Fried haben. Mach, daß d‘ weiterkommst!«
»Ah, da schau!« sagte der Fremde. Seine Stimme klang nicht mehr so fest, wie sie geklungen hatte, als er Ambros guten Abend gewünscht hatte. »Mir scheint, du nimmst mich für an andern?«
»Jesus!« stammelte Beda und fuhr zurück, als hätte sie einen Stoß vor die Brust bekommen.
Nun standen die beiden wortlos im Grau. Auch der Spitz war still und schnupperte vorsichtig am Hosenschaft des Fremden. Ein paar Sterne flimmerten schon aus dem erlöschenden Himmel herab. Und plötzlich hörte man das Rauschen der Wildach nimmer, weil aus dem offenen Giebelfenster des kleinen Hauses eine leidenschaftliche Flut von Klängen in den dunklen Abend herausschwoll. Die beiden auf der Straße schienen von dieser klingenden Sehnsucht nicht viel zu merken. Schweigend sahen sie einander an. Beda, als hätte die Verwechslung auch was Lustiges für sie, fing plötzlich zu lachen an. »Da hab ich mich aber grob verschaut! An dich hab ich freilich net denken können.«
»So? Gar net a bißl?«
»Seit wann bist denn wieder heim?«
»Heim muß ich erst noch kommen. Grad bin ich am Weg. Wie hat’s dir denn allweil gangen, die Zeit her?«
»Net schlecht! Und dir?«
»Wie’s halt gehn hat können! Is d‘ Wildacherin allweil wohlauf gewesen?«
»Allweil. Komm, Sully!«
Der Fremde sah den weißen Spitz an, der an Beda hinaufsprang. »Is dös noch allweil der gleiche?«
Die harmlose Frage schien auf Beda zu wirken wie ein Schimpf. Sie antwortete in Zorn: »Geht’s dich was an?«
»Angehn tut’s mich freilich nix. Aber was in der Heimat Brauch is, muß ich verlernt haben. Von der Fremd her bin ich’s gewöhnt, daß ich an Antwort hör, wenn ich frag um ebbes.«
»Hättst bloß a bißl denken brauchen, so hättst net fragen müssen. So a Hundl is net der Waldrauscher, der hundert Jahr alt wird. Den Sully hab ich seit zwei Jahr. No also, bist jetzt z’frieden?« Beda trat in den Hof und warf das Gattertürchen zu, daß es rasselte.
Der Fremde lachte. Dann guckte er in die Luft, als hätte er plötzlich die stürmischen Klänge vernommen, die aus dem dunkeln Giebelfenster herausfluteten.
»He! Du!«
Beda, schon bei der Haustür, wandte das Gesicht.
»Der da droben d‘ Orgelpfeifen so narret scheppern laßt, is dös ebba der städtische Mensch, der zu enk da einigangen is, a paar Minuten kann’s her sein?«
»Sonst haust keiner bei uns.«
»Entweder hab ich mich grad so verschaut wie du, oder ich tät druf schwören: Dös is kein andrer gewesen als der Lutzenbrosi?«
»Der Herr Lutz hat kein‘ Brudern. Da kannst dich net verschaut haben.«
Der Fremde schwieg, als hätte ihm diese Antwort was zu denken gegeben. Und Beda trat ins Haus, lockte den Hund zu sich heran und drückte die Tür zu. Eine Weile stand sie im finsteren Flur, umwirbelt von den schönen Klängen, die das kleine Haus durchhallten. Das dauerte dem weißen Spitz zu lang; er wollte in die Stube und scharrte an der Schwelle. Die Wildacherin öffnete die Tür, und matte Lampenhelle fiel in den Flur. »Aber Madl! Warum kommst denn net eini in d‘ Stuben? Oder tust auf d‘ Musi lusen?«
»A bißl, ja.«
»In der Stuben hört man’s grad so gut. Und an d‘ Arbeit mußt auch noch a bißl denken. Morgen is d‘ Wochen gar, und d‘ Schachtel mit der War muß fort.«
Beda trat in die Stube und wollte zum Tisch. Auf halbem Wege blieb sie erschrocken stehen, weil sie zu hören glaubte, daß einer durch den Hof zur Haustür kam.
»Jesses, Madl!« jammerte die Wildacherin. »Was hast denn? Bist ja mauerbleich übers ganze Gsicht! Hast dich verkühlt auf der Hausbank? Weil ich dir’s allweil sag, du sollst dich im leichten Stubengewandl net so aussihocken in d‘ Nachtkühlen!« Der Spitz fing zu kläffen an, und draußen polterte einer mit schweren Schuhen über die Stiege hinauf. »Wer trampelt denn da draußt umanand?«
Beda rückte die Handschuhnähmaschine in den Lichtkreis der Tischlampe. »Zum Herrn Inschenier is schon oft einer auffi.«
Die Wildacherin guckte hinaus. »He? Was is denn?«
»Geht’s da auffi zum Herrn Lutz?«
»Rechts ummi! Da bist gleich bei der Tür.«

Über den Schriftsteller:
Ludwig Ganghofer 1855-1920
Ludwig Ganghofer wurde am 7. Juli 1855 in Kaufbeuren als Sohn eines Forstbeamten geboren. Nach dem Abitur arbeitete er zunächst in einer Maschinenfabrik und begann anschließend ein Studium der Literaturgeschichte und Philosophie in München und Berlin; 1879 promovierte er in Leipzig. Ab 1880 schrieb er unter anderem Bühnenstücke und später zahlreiche Heimatromane, welche überwiegend in Berchtesgaden spielen. Seine Arbeiten machten ihn zum meistgelesenen deutschsprachigen Schriftsteller seiner Zeit. 1894 ließ er sich in München nieder, zog aber immer wieder hinaus in die Alpenwelt, die ihm literarisch als Inspirationsquelle diente. Ganghofer starb am 24. Juli 1920 am Tegernsee in Bayern.
Wer sich für die Verfilmung von Waldrausch interessiert und ignorieren kann, dass man den Spitz komplett vergessen hat, der freut sich vielleicht über die Schauspielkünste der jungen Uschi Glas: